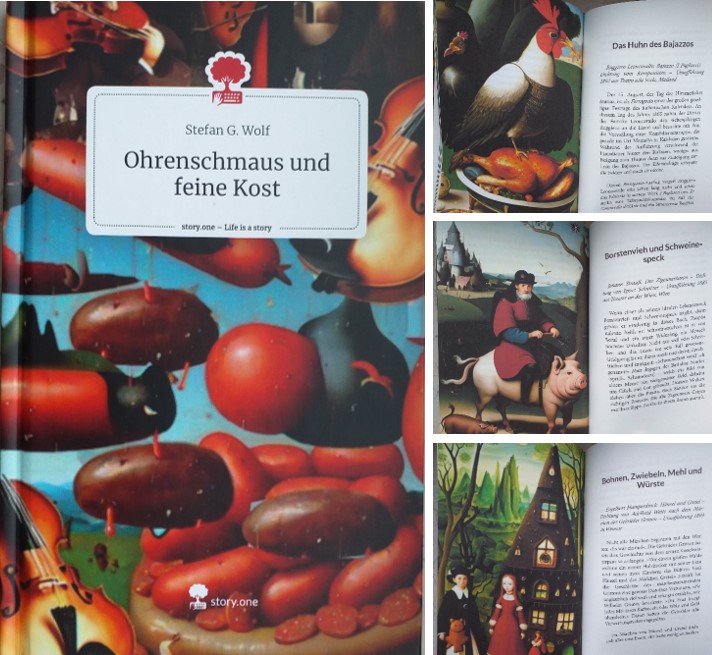
Bergener Fischsuppe
1 l Fischfond (Gibt es fertig in 1/2-Liter-Gläsern. Wer es weniger fischig haben möchte, der kann den Fischfond teilweise durch Gemüsebrühe ersetzen.)
500 g Filet vom Seelachs, Kabeljau, Rotbarsch, Heilbutt oder Lachs, mindestens aber drei Sorten – 1 Kartoffel – Karotte – 1 kl. Lauchstange – 2 Eigelb – 4 EL saure Sahne – 2 EL süße Sahne – Salz, Pfeffer – Petersilie
Die in Stücke geschnittene Kartoffel und die in Scheiben geschnittenen Karotten in den Fischfond geben und zum Kochen bringen. Die ganzen, leicht gesalzenen Fischfilets hineinlegen. Wenn die Suppe wieder aufkocht, den in dünne Scheiben geschnittenen Lauch zufügen und bei mittlerer Hitze sieden lassen. Alles in allem sollte der Fisch nicht länger als 15 Minuten garen. Danach nimmt man ihn heraus und zerteilt ihn in mundgerechte Stücke.
Die Eigelbe zerschlagen und nach und nach mit heißer Brühe verrühren. Dann ebenso allmählich die saure und die süße Sahne zugeben. Langsam in die heiße Suppe rühren, nicht mehr aufkochen. Würzen. Die Fischstücke wieder in die Brühe geben und noch einmal ganz vorsichtig erhitzen.
Mit gehackter Petersilie bestreuen.
„Steuermann, lass die Wacht!“
Richard Wagner: Der Fliegende Holländer – Dichtung vom Komponisten – Uraufführung 1843 an der Staatsoper, Dresden
„Diese Seefahrt wird mir ewig unvergesslich bleiben; sie dauerte drei und eine halbe Woche und war reich an Unfällen. Dreimal litten wir vom heftigsten Sturme, und einmal sah sich der Kapitän genötigt, in einem norwegischen Hafen einzulaufen.“ So beschreibt Richard Wagner im Rückblick seine Segelfahrt 1839 von Riga nach London, die eine abermalige Flucht vor seinen Gläubigern war. (»Besondere Umstände verleideten es mir, in Riga zu bleiben«, umschreibt er die pikante Situation.) „Die Durchfahrt durch die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Phantasie; die Sage vom fliegenden Holländer, wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigentümliche Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer verleihen konnten.“
Diese Seefahrt war alles in allem gar nicht lustig, und der Eindruck der Naturgewalten war so machtvoll, dass Wagner schon 1840 den Holländer-Stoff als Einakter, ein Jahr später in der endgültigen, dreiaktigen Form bearbeitete. Zum ersten Mal griff er damit einen Sagenstoff auf, wie er es von nun an stets tat: die Sage von dem holländischen Kapitän, den ein Fluch seit undenklichen Zeiten über die Weltmeere treibt. Alle sieben Jahre betritt er Land; sollte es ihm gelingen, auf einem solchen Landgang ein Weib zu finden, das ihm bis in den Tod treu ist, wäre seine Seele erlöst.
Wagner muss sich zu dieser Zeit selbst wie ein fliegender Holländer (zu Wasser und zu Lande) vorgekommen sein: Würzburg, Lauchstädt, Magdeburg, Königsberg, Riga, London, Paris waren innerhalb von nur sieben Jahren seine Arbeitsplätze. Nirgendwo konnte er dauerhaft Anker werfen.
Indessen hielten Norwegens Gestade für den Holländer eine Senta bereit, die seiner unruhigen Seele Erlösung versprach – wenn sie dies auch mit dem Leben bezahlte. Damit ist ein zweites Motiv angesprochen, das sich durch das weitere Wagnersche Opernschaffen zieht: das Ringen um Erlösung.
Die Matrosen auf dem Schiff nebenan am Kai haben andere Sorgen, die ihnen die Norwegermädels in Freude verwandeln: Mit Körben und Krügen entern sie das Schiff, das sich das gern gefallen lässt. Der Steuermann, so fordern die Seeleute ihren Kameraden auf, soll die Wacht lassen – na ja, im Hafen gibt’s ja auch nichts mehr zu steuern für den Mann. Und als die Mädels endlich an Bord sind, wissen die Matrosen gar nicht, wo sie zuerst hinlangen sollen. Ich schlage vor: Essen fassen!