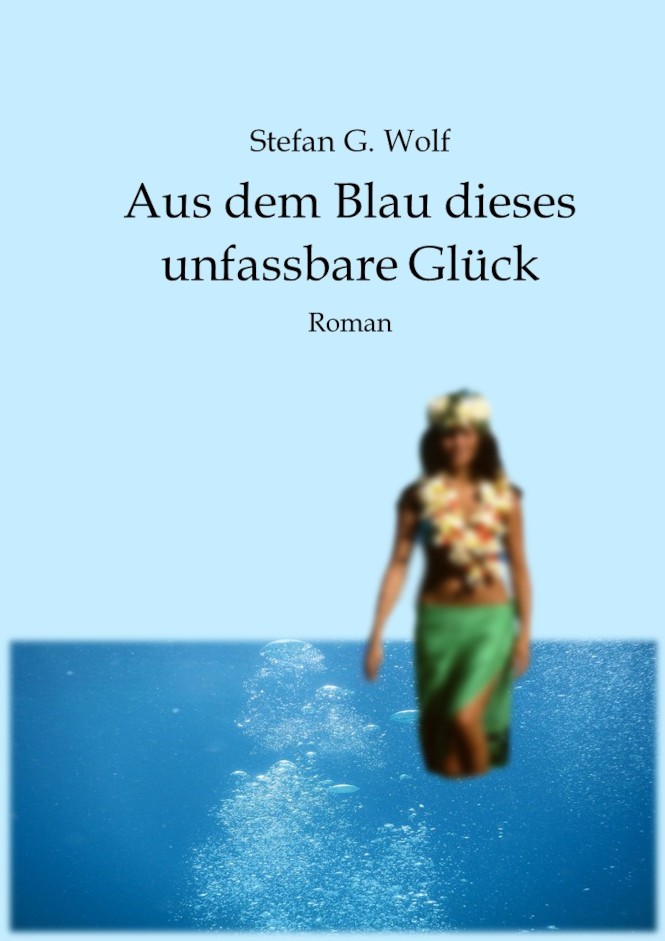
Leserstimmen
„Ich habe Ihr Buch mit Spaß innerhalb von zwei Tagen gelesen. Es war echt spannend.“
„Klasse! Liest sich sehr gut, tolle Sprache!“
„Der Traum, diese besondere Form des Bewusstseins, formt ein ganzes Leben, bis Traum und Leben eins werden – ein tröstender Gedanke, ein großartiges Buch“
Leseprobe
Wenn man in den Ort im Herzen Burgunds hineinfährt, kommt man – aus welcher Richtung auch immer – unweigerlich zur Kirche Saint Ghislain mit ihrem schiefen Dach. Davor liegt ein abschüssiger Platz, den die zweigeschossigen grauen Sandsteinfassaden mit verschlossener Miene anschweigen und an dessen unterem Ende das kleine Rathaus von St. Didier-les-Saules missmutig hinaufschaut, davor das Kriegerdenkmal. In der oberen Hälfte des Platzes zweigt links eine Gasse ab, schlägt einen Haken nach rechts, und da steht man schon vor dem Anwesen der Familie Robin: Wohnhaus, Hof, Werkstatt, ein paar niedrige Nebengebäude, dahinter ein trostloser Garten. Heute wohnt hier eine Frau aus Paris mit ihrem Freund, der aus Australien oder Neuseeland zugeflogen sein soll. Sie gibt Malkurse, im Sommer ist das Haus voll, viele Frauen, auch einzelne Männer. Dann und wann zieht eine Gruppe, bepackt mit Staffeleien, Mal- und Picknickutensilien früh morgens hinaus in die Natur, manchmal sitzen sie alle im Hof, es wird viel geschwiegen und dann wieder viel gelacht. Was sie sonst so machen, wo sie alle schlafen: Wen interessiert das heute noch? Einmal im Jahr, außerhalb der Saison, veranstaltet Mélanie, die Malerin, eine Ausstellung im Atelier, das mal eine Werkstatt war, „um den Bürgerinnen und Bürgern von St. Didier-les-Saules etwas zurückzugeben“, wie sie sagt. Die kommen auch, schauen sich die Bilder an, trinken ein Glas Wein, das ihnen Neil, der Australier (oder Neuseeländer) eingießt, und gehen wieder. Gekauft hat noch niemand jemals etwas.
(…)
Clément hatte verstohlen zu Vater hinübergeschaut, der nur den Kopf schüttelte, während er weiter seine Suppe löffelte. Mutter aber hatte dem Großvater die Hand auf den Arm gelegt und gezischelt: »Nicht vor dem Bub!« Und zu diesem gewandt, weil ja die Sache nun mal aus der Welt geschafft werden musste: »Père Yrigoyen war bei den Partisanen gegen die Deutschen, verstehst du, und da war er einmal dem Tod so nah, dass er ein Gelübde abgelegt hat, wenn er in Friedenszeiten seine Eltern wiedersehen sollte, dann würde er der Kirche dienen.«
»Partisan, da muss ich lachen!« hatte Großvater gemurmelt und gelacht.
Suppentröpfchen hatten sich dabei auf dem Tisch verteilt und Mutter hatte wieder gezischelt: »Alphonse!« Clément hatte wenig verstanden vom Tischgespräch und machte das, was Kinder in solchen Fällen zu tun pflegen: Er machte sich seinen eigenen Reim darauf.
»Leib und Blut unseres Herrn« rief der Seelenhirte nun, »Mysterium«, »Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle«. (…) »Gegenwart Gottes«, »Ausdruck seiner unendlichen Liebe« rief der Pfarrer. Da wanderten Cléments Gedanken zu Nana und ihr Unterhöschen, bis ihm sein linker Banknachbar einen Zettel zusteckte. Er öffnete ihn und erschrak. Jemand hatte mit groben und kritzeligen Bleichstiftstrichen Père Yrigoyen gezeichnet, wie er den Schafen und Ziegen predigte. Clément ließ den Zettel fallen wie eine glühende Kohle. »Du Idiot!« zischte der Junge neben ihm und sah dem Zettel nach, der unerreichbar unter dem Kniebrett in der Reihe vor ihnen niedergesunken war.
»Gibt es da hinten etwas, das ich wissen müsste?« schnarrte Père Yrigoyen, und als die Mädchen zu laut kicherten und von den Knaben keine Antwort zu erwarten war, ging er zum Agnus Deus über. »… qui tollis peccata mundi …« Der Baske dirigierte den Chor der Kinderstimmen und hieb mit kurzen Handkantenschlägen den Takt. »… miserere nobis.« O Herr, der du die Sünden der ganzen Welt auf deine Schultern nimmst, erbarme dich über dein kleines Volk, denn sie wissen ja noch gar nicht, was sie tun. Yrigoyen sprach jetzt so laut mit, dass man die Kinder kaum noch hörte. »… dona nobis pacem!«
In die folgende Stille hinein hörte man die Kirchentür knarzen. Es waren Odette und Raymonde, die beiden Schwestern des Bürgermeisters, die stets als erste zur samstäglichen Beichte erschienen. Der Pfarrer ließ sich zur Eile drängen. »Wir wollen mit dem Segen des Herrn uns auf das Christkönigsfest einstimmen und knien dazu nieder. Und ich sage es gleich: Ich will euch alle morgen zur Heiligen Messe sehen!« Da kniete das Häuflein Christenheit in der Spannung zwischen der baskischen Geißel und der Labsal eines ungezwungenen Nachhausewegs, für den einige sich schon Kurzweiliges ausgedacht hatten, die da unruhig wackelten und zappelten und sich gegenseitig in die Seite stießen und nach rechts zu den Mädchen schielten, während der Père mit weit ausholenden Gesten das Kreuz über ihnen schlug.
(…)
Es war ein besonderer Tag, nicht ausgelassen fröhlich, wie das Weihnachtsfest in Familien gefeiert werden mochte, die auf diesen Tag hingelebt hatten als den wichtigsten des Jahres mit allerhand Vorbereitungen, vom Einkaufen, Kochen und Backen, dem Dekorieren und Ausschmücken des Hauses, dem Basteln, Kaufen und Verpacken von Geschenken bis hin zur inneren Einkehr, dem Fasten, der Beichte am Vortag. Der Tag enttäuschte aber auch niemanden in der Rue de l’oubli, wie es dort geschehen mochte, wo die Erwartungen aller an alle hoch, der eigene Beitrag niedrig, der Anspruch an das Leben genauso ungezügelt wie die gescheiterten Hoffnungen groß waren, wo man schnell bereit war, Schuldzuweisungen auszusprechen, niedrig die Schwelle der Frustration, kurz der Weg zur Verbitterung und – schlimmstenfalls – groß die Bereitschaft zur Gewalt gegen andere oder sich selbst. Es war ein heiterer Tag, an dem sich alle drei entspannt, gelassen und einander zugewandt verhielten. Man war zufrieden mit Essen und Trinken und der Geselligkeit, die nichts verlangte außer ein wenig Vertrauen und Nachsicht. Es wurde viel gelacht, nicht immer wusste jeder warum, jeder erzählte ein, zwei kleine Geschichten aus seinem Leben, da wo es gerade in die Unterhaltung passte und gerade so viel, dass die anderen nicht Schlüsse grundsätzlicher Art ziehen konnten. Wie Marie ihren zweiten Mann, LeGoff, den Vater Normands und eines Mädchens, die Eier abbiss – fast, fast! schränkte sie gleich ein, bevor das ›Oho! O làlà!‹ zu ungestüm wurde –, als sie erfuhr, dass er sich gleichzeitig mit ihrer Stiefmutter und ihrer Schwester vergnügte. (Marie war damals mit ihrer Tochter schwanger, von der sie nichts weiter erfuhren, als dass sie Carla hieß und irgendwo auf dieser Welt lebte.) Oder wie Tiago – er war dreizehn oder vierzehn Jahre alt – in die Küche kam, als seine Mutter gerade auf seinen Vater schoss. (»Du papistische Hure!« hatte dieser zuvor ausgerufen, erinnerte sich Tiago; sein Vater war ein in der Wolle gefärbter Kommunist.)